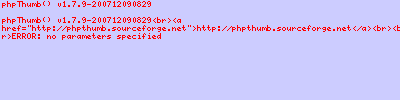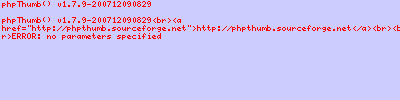Was teure Fonds vor dem schleichenden Tod rettet
In der Wissenschaft gilt es als gesichert: Teure Fonds schneiden nach Kosten schlechter ab als billige Konkurrenten. Doch warum sind die Gebühren-Dinosaurier nicht längst ausgestorben? Drei kanadische Forscher fahndeten nach den Ursachen – und präsentieren nun eine überraschende Antwort.
Der Kauf eines teuren Autos verspricht eine bessere Qualität als ein preiswerteres Modell. Dieses Prinzip scheint in der Fondswelt nicht zu gelten. Das belegen jedenfalls zahlreiche Studien. In der Finanzwissenschaft war bislang ausgemacht: Teure Fonds liefern im Schnitt keine bessere Leistung ab als günstigere Konkurrenten. Im Gegenteil: Nach Abzug der Kosten bleibt Anlegern von Premium-Portfolios im Schnitt sogar weniger Rendite, so die vorherrschende Meinung.
In die gleiche Richtung stießen erst jüngst zwei Untersuchungen. Die eine erkannte keinen direkten Zusammenhang zwischen Kosten und Qualität, die andere sah Billig-Fonds klar im Vorteil. Doch warum "überleben" dann Portfolios, die eine höhere Gebühr verlangen? Eigentlich müssten diese wie einst die Dinosaurier akut vom Aussterben bedroht sein.
Dieser Frage gingen drei Forscher der Universitäten von Vancouver und Toronto nach. Das überraschende Urteil der Kanadier räumt mit dem "Billig-ist-besser-Klischee" auf: Teure Fonds bieten demnach tatsächlich eine größere Chance auf höhere Renditen.
Rasantes Wachstum ummünzen
Ein möglicher Grund: Die Manager der Premium-Portfolios investieren bevorzugt in Aktien von Unternehmen, deren Bilanzsumme rasch wächst, die von Zeit zu Zeit neue Aktien ausgeben, aber auch eine geringere Profitabilität aufweisen – sprich: die Hochpreis-Fonds investieren offenbar gerne in Wachstumstitel. Münzen diese Unternehmen ihr rasantes Wachstum irgendwann auch in hohe Profite um, winken hohe Kursgewinne. Das spiegelt sich dann in den zu erwartenden Fondsrenditen wider, so die Forscher. Zudem fanden die Akademiker heraus, dass die Premium-Manager in Unternehmen investieren, die geschäftlich arg verschachtelt und daher schwierig zu analysieren sind. Stimmt diese These, wäre die höhere Gebühr auch gerechtfertigt.
Im Detail untersuchten die Ökonomen Jinfei Sheng, Mikhail Simutin und Terry Zhang US-Aktienfonds und schlossen dabei auch Portfolios ein, die aufgelöst oder verschmolzen wurden. Sie prüften also nicht nur die Fonds, die überlebten (sogenannte "survivor bias"). Zudem legten sie ihrer Auswertung mehr Faktoren zugrunde als bisherige Studien – was zu dem überraschenden Ergebnis führte. Die Autoren orientierten sich dabei an den neuesten Erkenntnissen der Nobelpreisgewinner Eugene Fama und Graham French.
Diskussion befeuert
Ob sich die Kanadier mit ihrer These in der Praxis durchsetzen, ist aber offen. Denn bislang legten die drei lediglich ein Arbeitspapier vor. Es unterlag damit noch keiner eingehenden, methodischen Prüfung einer Kommission wie bei akademischen Publikationen üblich. So könnte eine falsche Methodik oder andere, von den Kanadiern nicht bedachte Faktoren das Ergebnis verfälscht haben. Dennoch birgt das Papier reichlich Sprengkraft, die Diskussion über die Gebühren von Fonds in der Wissenschaft wie im Berateralltag anzufachen. (ert)