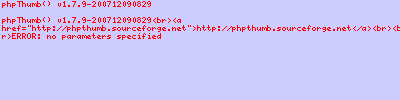Studie: Boni machen Manager zu Indexschmusern
Erfolgsabhängige Prämien sollen Portfoliomanager zu Spitzenergebnissen antreiben. Doch eine Studie zeigt: Das ist leider nicht immer der Fall. Manchmal verzerren falsch gesetzte Boni sogar die Kurse an den Börsen.
Die Aussicht auf einen üppigen Bonus spornt zu Höchstleistungen an – dies ist jedenfalls der Hintergedanke der meisten Gehaltsvereinbarungen für Fondsmanager. Doch eine Studie lässt Zweifel aufkommen, ob dieser Grundsatz auch wirklich stimmt. Denn in einer Untersuchung kommt ein Absolvent der London Business School (LBS) zu dem Ergebnis, dass die Aussicht auf hohe Prämien Portfolioprofis nicht in allen Marktphasen zu Bestleistungen anspornt.
So verglich Studienautor Anton Lines die Investmententscheidungen von Portfoliomanagern und die Kursentwicklung an den Märkten von 2008 bis 2014. Das Ergebnis: Nehmen die Schwankungen an den Märkten zu, rücken die aktiven Manager bei der Titelauswahl näher an ihren Vergleichsindex heran. Steuern die Börsen dagegen in ruhiges Fahrwasser, fassen die Manager wieder mehr Mut und wagen auch selbstbewusste Wetten abseits der Vorgaben der Benchmark.
Starke Nerven in Stressphasen
Zudem verglich der LBS-Akademiker das Anlageverhalten der Fondslenker mit dem von Investmentmanagern bei Banken, Versicherern oder Pensionskassen, die keine Boni erhalten. Das erstaunliche Resultat: Die schlechter bezahlten Renditesammler neigen der Auswertung zufolge nicht dazu, sich in Stressphasen am Vergleichsbarometer entlangzuhangeln. Der sinkende Risikoappetit in Krisenzeiten lässt sich also nicht allein durch psychologische Effekte oder Investmentrichtlinien erklären. Zudem schloss Lines aus, dass Mittelabzüge durch Anleger die "Indexschmuserei" der Manager verursachen.
Der Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass das bonusgesteuerte Verhalten der Asset Manager sogar die Wertentwicklung an den Märkten verzerrt. Denn wenn in Krisenzeiten Portfoliokapitäne in Scharen ihre Portfolios auf den Index ausrichten, verstärke dies den Preisdruck auf Aktien, die nicht oder nur gering in Barometern vertreten sind. Demgegenüber erhöhe sich künstlich der Kurs von Aktien, die ein großes Gewicht in den Benchmarks einnehmen. (ert)