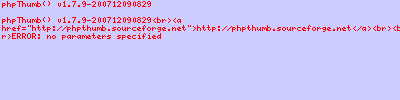Finanzaufsicht beklagt zu hohe Fondsgebühren
Die britische FCA hat die Kosten in der heimischen Fondsbranche genauer beleuchtet. Das ernüchternde Ergebnis: Viele Manager verlangen hohe Gebühren, liefern aber keine entsprechende Leistung. Die Behörde will daher Asset Manager in die Pflicht nehmen.
Die britische Fondsindustrie hatte einmal in einer Studie versteckte Gebühren als "Monster von Loch Ness" bezeichnet – es gebe sie schlichtweg nicht. Doch die Finanzaufsicht des Landes kommt nun zu einem ganz anderen Schluss. Nach einer eingehenden Prüfung des Fonds-Universums der Insel hat die Financial Conduct Authority (FCA) einen mangelhaften Wettbewerb ausgemacht, der zu überhöhten Preisen im aktiven Management führe. Anleger würden oftmals überzogen hohe Gebühren zahlen, die nicht durch entsprechende Mehrrenditen der Manager gerechtfertigt seien, so das vernichtende Urteil (lesen Sie hierzu auch den Kommentar von FONDS professionell-Chefredakteur Bernd Mikosch: "Angriff von unerwarteter Seite").
Die FCA hatte im November 2015 begonnen, die Preisstrukturen und die erbrachten Anlageresultate in der Fondsindustrie unter die Lupe zu nehmen. Nun veröffentlichte die Aufsicht einen Zwischenbericht, die endgültige Fassung soll 2017 folgen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund sieben Billionen britischen Pfund (mehr als acht Billionen Euro) rangiert die Londoner Fondsindustrie weltweit an zweiter Stelle.
Umfangreiche Mängelliste
In ihrer Studie sieht die Behörde die Anlageziele einiger Produkte nicht klar genug definiert. Zudem werde die erbrachte Leistung nicht immer mit den korrekten Vergleichsbarometern gemessen. Trotz der großen Anzahl an Playern im Markt lägen die Preise oftmals erstaunlich nah beieinander – was dazu führe, dass die Branche insgesamt daher seit Jahren hohe Profite einstreiche. Zwar sei die Konkurrenz bei Indexfonds deutlich schärfer, doch auch hier gebe es Verdachtsfälle, in denen Anleger für ihr Geld nur eine schwache Leistung erhalten würden.
Auch in der Anlageberatung sehen die Aufseher Nachholbedarf. Der Zunft gelinge es nicht effektiv gut, Manager anhand ihrer erbrachten Investmentleistung auszuwählen und zu fördern. Zudem sieht die Behörde Interessenkonflikte im branchentypischen Geschäftsmodell, die sie noch genauer untersuchen will.
Aus den ernüchternden Ergebnissen zieht die Aufsicht harte Konsequenzen und legt nun Vorschläge für ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor. So sollen generell die für Anleger anfallenden Gebühren und Kosten besser aufgeschlüsselt und dargestellt werden.
Die Aufsicht erwägt daher, eine "all-in fee" einzuführen. Diese soll auf einen Blick alle Kosten aggregiert anzeigen. "Wir wollen eine größere Transparenz schaffen, sodass Anlegern klar ist, was sie bezahlen und welchen Einfluss die Gebühren auf die Rendite haben", sagte FCA-Chef Andrew Bailey bei der Präsentation des Untersuchungsberichts.
Kostendeckel als letzte Waffe
Zudem sollen die Investmentziele der einzelnen Portfolios klarer dargestellt und bessere, transparente Vergleichsmaßstäbe herangezogen werden. So sollen Anleger besser ablesen können, ob ihr Fonds eine schwache, eine durchschnittliche oder eine exzellente Leistung abliefert. Außerdem soll der Wechsel in günstigere Anteilsklassen erleichtert werden.
Schließlich sollen Anbieter angehalten werden, stets im Interesse der Kunden zu handeln. Eine Obergrenze für Gebühren will der FCA-Chef jedoch nicht einführen. "Wenn man den Wettbewerb ankurbeln will, ist das nicht unbedingt die beste Idee", so Bailey. "Eine Preisgrenze wäre nur der letzte Ausweg."
Die Ergebnisse der Prüfung überraschen insofern, als dass die Gebühren im britischen Fondsmarkt seit Einführung des Provisionsverbots im Jahr 2013 schon deutlich gefallen sind. So zeigte eine Studie der Ratinggesellschaft Morningstar, dass in Großbritannien die Fondskosten seit 2013 im Schnitt um 43 Basispunkte abnahmen. Über alle Klassen hinweg gesehen rangiert die Insel damit unter dem europäischen Durchschnitt.
In Deutschland ist die durchschnittliche Kostenbelastung dagegen sogar noch gestiegen. Grund hierfür ist laut Morningstar nicht zuletzt der Boom von Multi-Asset-Produkten, die aufgrund ihrer wachsenden Beliebtheit den Anbietern beinahe unabhängig von der berechneten Gebühr aus den Händen gerissen wurden. (ert)