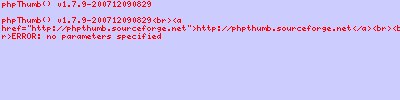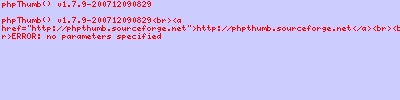Mifid II: Wie Analysten in der neuen Welt arbeiten
Wegen der neuen Finanzmarktregeln dünnen Fondsanbieter die Reihen externer Analysedienste aus. Hauseigenes Research halten die Firmen hingegen hoch. FONDS professionell erhielt Einblick, wie das Analystenteam eines großen Asset Managers arbeitet.
Der Blick aus dem Konferenzraum geht direkt auf die ehrwürdige St. Paul’s Cathedral im Herzen von London. Während draußen die Touristenscharen das imposante Bauwerk bewundern, richten drinnen alle ihren Blick gebannt auf die Kurven, die an die Wand geworfen werden: Konjunkturindikatoren, Dollarkurs, Ölpreis, Anleiherenditen. Die Lage an den Märkten ist angespannt. Fährt die US-Notenbank die expansive Geldpolitik noch weiter zurück? Was bedeutet das für die Weltkonjunktur – und die Schwellenländer?
Um genau die geht es hier in dem spartanisch eingerichteten Konferenzraum. Das Team für Emerging-Markets-Anleihen des Fondshauses Fidelity International trifft sich zu seiner wöchentlichen Besprechung. Rund um den großen Holztisch sitzen Portfoliomanager, Länderexperten, Trader, ein quantitativer Analyst sowie ein Kollege aus dem Bereich Schwellenländer-Aktien. Per Video-Übertragung sind noch die Kollegen aus Hongkong zugeschaltet.
Fondsmanager Steve Ellis wirft die Frage in die Runde, ob angesichts sich eintrübender Einkaufsmanagerindizes und des fortschreitenden Zinszyklus der Gegenwind für Emerging-Market-Anleihen zunimmt. Immer mehr Investoren scheinen Geld aus der Anlageklasse abzuziehen. Prompt setzt eine rege Diskussion ein. Am Ende dreht sich alles um die Frage, wie einer der Fonds, den das Team betreut, am besten im derzeitigen Umfeld aufgestellt ist.
Die Krux: kein konkreter Preis
So wie hier bei Fidelity in London beleuchten auch bei anderen Asset Managern Research-Teams die Aussichten für die Märkte und fahnden nach lukrativen Titeln, seien es Aktien oder Anleihen. Das Thema Research erlangte zuletzt erhebliche Brisanz. Denn seit Einführung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II müssen die Akteure offenlegen, wie viel Geld sie für externe Analysen bezahlen. Die Krux daran: Bislang hatten die Studien keinen konkreten Preis. Die Investmentbanken und Brokerhäuser lieferten die Einschätzungen quasi frei Haus im Gegenzug für lukrative Handelsaufträge. Den Regulierern schien diese Praxis zu undurchsichtig.
Ein Kernpunkt bei der Diskussion war, wer die Gebühren trägt, die bislang nur indirekt unter dem Punkt Transaktionskosten in den Jahresabschlüssen der Portfolios aufgeführt waren: die Fondsanleger oder die Anbieter. Nach und nach entschieden sich immer mehr Häuser dafür, die Kosten auf ihre Kappe zu nehmen.
Sparen am falschen Ende?
Branchenbeobachter verweisen aber auf eine Gefahr: Wenn die Anbieter die Gebühren selbst stemmen, sei die Versuchung groß, bei diesem Posten zu sparen. Solche Kürzungen gingen letztlich zulasten der Anleger, da diese weniger gute Investmententscheidungen erhielten. Solche Kürzungen könnten nicht nur externe Dienstleister treffen, sondern auch die internen Research-Abteilungen.
Demgegenüber steht die Hoffnung, dass die Asset Manager die Ausgaben, die sie bei externen Dienstleistern einsparen, im eigenen Haus investieren und neue Stellen aufbauen. Umfragen unter Fondshäusern zeigen, dass sie tatsächlich die Nutzung externer Analysedienste zurückfahren wollen. Oftmals seien darunter auch "verzichtbare Studien", die keinen großen Erkenntnisgewinn bieten. "Wenn 20 Analysten den Apple-Konzern beobachten, dann braucht man nicht unbedingt noch den 21. Analysten", formuliert es Martin Dropkin, Leiter des Anleihen-Research bei Fidelity. Die Budgets für Studien sollen Umfragen zufolge mehr oder weniger gleich bleiben. Tatsächlich könnte die Fondshäuser also ihre hauseigene Kompetenz ausbauen wollen. Noch sind aber viele Häuser in der Findungsphase.
Angola oder Uruguay
Mit solchen unternehmensstrategischen Entscheidungen muss sich das Schwellenländer-Anleihen-Team von Fidelity in London nicht herumschlagen. Hier geht es um handfeste Anlageentscheidungen: Sollen die Bonds eines mexikanischen Ölkonzerns gegen Papiere aus Uruguay getauscht werden? Wie wahrscheinlich ist ein Regierungswechsel in Venezuela – und lohnt daher ein Einstieg? Und wie steht es um die Wirtschaft und die Staatsfinanzen Angolas? Um all diese Fragen zu klären, sind die Analysten zuvor ausgeströmt und hatten sich durch Datenberge geackert, mit Finanzministern der Länder sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen und Journalisten gesprochen – und sich daraus ein eigenes Bild geformt. (ert)





 Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Vortrag am FONDS professionell KONGRESS