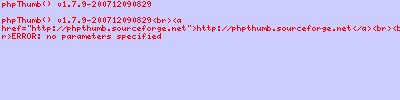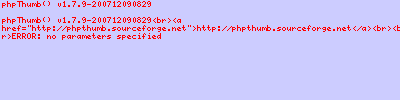Negativzinsen: Verschnaufpause für Banken
Laut OGH müssen Negativzinsen nicht an Kreditkunden weitergegeben werden. Ein Urteil zur Festlegung des Mindestzinssatzes steht noch aus. Einen Überblick über die aktuelle Rechtslage gibt die Kanzlei Brandl & Talos Rechtsanwälte.
Bei variabel verzinsten Krediten zwischen Banken und Kreditnehmern werden in der Regel Zinsgleit- oder Zinsanpassungsklauseln vereinbart. Nach diesen Klauseln setzt sich der insgesamt vom Kreditnehmer an die Bank zu zahlende Zinssatz aus dem (veränderlichen) Indikator wie beispielsweise dem Euribor oder dem Libor und dem (unveränderlichen) Aufschlag auf diesen Indikator zusammen. Der Referenzzinssatz bildet dabei das allgemeine Zinsniveau ab, während der Aufschlag das Ausfallrisiko abdecken und darüber hinaus der Bank ihren Ertrag bringen soll.
Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie deren Auswirkungen auf die Geldmarktpolitik der Notenbanken sind die Referenzzinssätze auf ein historisch niedriges Niveau gesunken und befinden sich aktuell sogar im negativen Bereich. Aufgrund der aktuellen Zinssituation ist es derzeit möglich, dass das Zinsniveau der Indikatoren so weit ins Negative gerutscht ist, dass die von den Kreditnehmern zu zahlenden Zinsen rechnerisch selbst unter Hinzurechnen des Aufschlags negativ bleiben. Sinkt der Euribor etwa auf minus 1,5 Prozent, dann wäre der Sollzinssatz nach der Zinsbildungsklausel unter Berücksichtigung eines Aufschlags von beispielsweise einem Prozent bei minus 0,5 Prozent. Das würde theoretisch bedeuten, dass nicht der Kreditnehmer, sondern die Bank für einen von ihr vergebenen Kredit Zinsen zahlen müsste.
Aus rechtlicher Sicht knüpft sich daran die spannende Frage, ob es zu einer solchen Zahlungspflicht kommen kann; und falls die Antwort ja lautet, in welcher Höhe. Vom obigen Beispiel ausgehend: Muss die Bank die negativen Zinsen von 1,5 Prozent zur Gänze an den Kreditnehmer weitergeben oder kann der Zinssatz nur auf maximal null Prozent fallen? Steht der Bank möglicherweise in jedem Fall zumindest der Aufschlag von einem Prozent zu, auch bei Negativzinsen?
Gutachten
Als die Referenzzinssätze im Sinken waren, begannen die Banken für die beschriebene Situation vorzubauen. Sie verständigten ihre Kreditnehmer darüber, dass sie bei negativen Werten des vereinbarten Referenzzinssatzes entweder einen Zinssatz von zumindest null oder in der Höhe des vereinbarten Aufschlags verrechnen werden – dies unabhängig von getroffenen Vereinbarungen, die einen solchen Mindestzins in der Regel nicht vorsahen. Nicht alle Kreditnehmer wollten das auf sich sitzen lassen und zogen vor Gericht. In einem Gerichtsverfahren legte eine Bank ein bemerkenswertes Gutachten vor, in dem vor einer Bankenpleite gewarnt wird. Demnach wäre die wirtschaftliche Existenz jener Banken, die sich zu einem bedeutenden Teil über Einlagen refinanzieren, gravierend gefährdet, sollten die negativen Referenzzinssätze zur Gänze an die Kreditnehmer als Negativzinsen weitergegeben werden müssen. Spätestens nach Bekanntwerden dieses Gutachtens griffen die Medien dieses Thema auf, sodass erstmals die breite Öffentlichkeit auf die Negativzinsen aufmerksam wurde.
Die wechselseitigen Argumente
Die Banken beziehen sich in den anhängigen Gerichtsverfahren zumeist darauf, dass Negativzinsen nicht der gesetzlichen Definition eines Kreditvertrags entsprächen. Ein Kreditvertrag sei ein entgeltlicher Darlehensvertrag über Geld. Daraus sei, so das Vorbringen der Banken, abzuleiten, dass Kreditnehmer Zinsen zu zahlen haben. Außerdem seien nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs Spareinlagen auf einem Sparbuch jedenfalls zu verzinsen. Daher müssten auch bei einem Kreditvertrag zwingend Zinsen zugunsten des Kreditgebers anfallen.
Die Kreditnehmer stützen sich vorrangig auf das Konsumentenschutzgesetz, wonach bei einer automatischen Entgelterhöhung etwa bei Koppelung des Entgelts an einen Indikator auch die Möglichkeit einer Entgeltsenkung vorgesehen sein müsse. Die Kreditgeber müssten demnach die Negativzinsen in vollem Umfang an die Kreditnehmer weitergeben. Das Verrechnen einer nicht vereinbarten Mindestverzinsung sei unzulässig.
Was sagen die Gerichte?
Nach Erlass der ersten Urteile zeichnete sich ab, dass es Banken verboten sein soll, die Zahlung von Negativzinsen an Kreditnehmer generell auszuschließen. In diesem Sinne entschied das Handelsgericht Wien im September 2015. Demnach könne der Wert des Indikators auch ins Negative drehen und sei nicht bei null "einzufrieren". Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass vereinbarte Zinsanpassungsklauseln weder Ober- noch Untergrenze kennen. Es wäre der Bank offengestanden, bei Abschluss der Kreditverträge Beschränkungen der Zinsentwicklung nach oben sowie nach unten vorzusehen. Das Gericht folgte damit überwiegend der Argumentationslinie des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Demgegenüber setzte sich das Oberlandesgericht Wien als zweite Instanz mit der entsprechenden Klage des VKI inhaltlich nicht auseinander, sondern wies die Klage aus formellen Gründen ab.
OGH-Urteil
Schließlich fällte der Oberste Gerichtshof im März 2017 ein wegweisendes Urteil. Demnach seien bei einem "typischen Fall" eines Kredits Kreditnehmer und Kreditgeber regelmäßig darüber einig, dass der Kreditnehmer als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Kreditvaluta wiederkehrende Zinszahlungen zu leisten habe. Ein Kreditnehmer werde bei Vertragsabschluss nicht damit rechnen, für den erhaltenen Kredit vom Kreditgeber Zinsen zu erhalten. Genauso wenig sei der Kreditgeber gewillt, Zahlungen an den Kreditnehmer zu leisten.
Es bestehe insofern, so der Oberste Gerichtshof in seiner Begründung, beim Kreditvertrag allgemein ein übereinstimmender Parteiwille darüber, dass eine Zahlungsverpflichtung der kreditgebenden Bank an den Kreditnehmer ausgeschlossen ist. Kreditgeber und Kreditnehmer gehen im Allgemeinen bei Vertragsabschluss davon aus, dass der Kreditnehmer als Entgelt für die Zurverfügungstellung eines Geldbetrags für die jeweilige Zinsperiode Zinsen zu zahlen hat. Ein Kreditnehmer könne nicht damit rechnen, dass der Kreditgeber einer Zahlungspflicht in Form von Negativzinsen zustimmen wird und damit möglicherweise weniger zurückerhält, als er zur Verfügung gestellt hat.
Den gesamten Artikel von Mag. Christian Lenz und Mag. David Zlabinger, beide Mitarbeiter der auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei Brandl & Talos Rechtsanwälte, finden Sie in der aktuellen Heftausgabe 2/2017 von FONDS professionell, die Ende Mai erscheint.