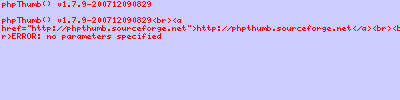Value-Manager: "Modelle, die nur wirken, wenn man sie nicht braucht"
Von Tulpen, Truthähnen und Schwarzen Schwänen: Hans Peter Schupp, Vorstand der Fondsboutique Fidecum, geht im Interview mit FONDS professionell ONLINE mit dem Thema Statistik im Portfoliomanagement und den darauf basierenden Investmentmodellen hart ins Gericht.
Statistische Kennziffern, die ihrer Entstehung entsprechend aus der Vergangenheit stammen, sind – trotz dieses quasi naturbedingten Mangels – aus den Modellen des Portfoliomanagements nicht mehr wegzudenken. Im Grunde weiß daher jeder, dass die daraus abgeleiteten Prognosen und Trends nicht wegzudiskutierende Schwächen aufweisen. Kein Wunder, dass so eine Art Scheinsicherheit entsteht, die oft genug mit Verlässlichkeit verwechselt wird. Hans Peter Schupp, Vorstand von Fidecum mit Sitz in Bad Homburg und Portfoliomanager des Contrarian Value Euroland Fonds, warnt daher im Interview nicht ohne Grund davor, sich als Fondsmanager mit seinen Modellen allzu sehr auf der sicheren Seite zu wähnen.
Herr Schupp, Sie berechnen und veröffentlichen viele quantitative Kennziffern zu Ihren Fonds. Im Portfoliomanagement nutzen Sie diese aber genauso wenig wie die Tools der Portfoliooptimierung. Warum solche Vorbehalte?
Hans Peter Schupp: Wenn Sie eine Straße überqueren, schauen Sie nach links und rechts, um sich zu versichern, ob ein Auto kommt. Oder würden Sie etwa die Wahrscheinlichkeit dafür aus der historischen Verkehrsfrequenz berechnen? Die sogenannte Moderne Portfoliotheorie macht Letzteres, da sie ausschließlich historische Kursverläufe, erzielte Renditen und deren Schwankungen berücksichtigt. Begründet wird dies mit der Effizienzmarkthypothese, die in ihrer allgemeinen Form besagt, dass Wertpapierpreise zu jeder Zeit alle verfügbaren Informationen beinhalten und damit weitere Analysen obsolet sind. Gesucht werden dann Wertpapiere, deren Kursverlauf sich in der Vergangenheit nicht gleichläufig entwickelt hat, mit dem Ziel, ein Portfolio daraus zu konstruieren. Dieses Portfolio ist weniger schwankungsanfällig, weil andere Wertpapiere eine mögliche Fehldisposition kompensieren.
Von daher ist der Vorteil einer entsprechenden Diversifikation doch im Grunde unbestreitbar?
Hans Peter Schupp: Man könnte natürlich sehr vereinfacht sagen, dass ein Straßenhändler, der eben noch Sonnenbrillen verkauft hat, sinnvollerweise meist auch Regenschirme im Repertoire hat, um diese anzubieten, sobald die ersten Tropfen fallen. Die Frage ist jedoch, ob historische Kursverläufe, Renditen und deren Schwankungen, wie sie die Quantitative Portfoliotheorie verwendet, das richtige Selektionskriterium zur Absicherung gegen Eventualitäten sind. Spätestens seit 1637, dem Jahr der sogenannten "Tulpenmania", wissen wir, dass die gefährlichsten Investments Spekulationsblasen sind. Weil ausschließlich die Hoffnung auf neues Anlegerkapital den Kurs begründet.
Was natürlich in erster Linie von deren Kursverlauf vor dem Platzen der Blase herrührt, im Grunde jene Phase, in der sie als optimale Investments zur Portfoliooptimierung erscheinen.
Hans Peter Schupp: Vollkommen richtig, ich würde sogar noch ergänzen, dass Folgendes erschwerend hinzu kommt: Spekulationsblasen vereinen hohe Renditen mit einer in der Regel nur geringen Schwankungsbreite und einer nur geringen Korrelation zu anderen Wertpapieren. Das ist der eigentliche Grund, weshalb Anleger eben häufig der sogenannten "Truthahn-Illusion" unterliegen. Das ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik, der das Aufkommen überraschender Trendbrüche damit erklärt, dass die Ursachen und Rahmenbedingungen für einen Trend nicht hinterfragt werden. Das ist aus meiner Sicht in gewisser Weise genauso ein Mysterium wie die immer noch sehr beliebte Risikokennziffer "Value at Risk"...
… deren Aussage sich aber doch – einmal abgesehen von den eben immer verbleibenden Residualrisiken – erstmal durchaus plausibel anhört?
Hans Peter Schupp: Ich gebe Ihnen sogar Recht, wenn man davon ausgeht, dass eine Kennziffer wie "Value at Risk" mit einer Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 99,5 Prozent das maximale Verlustrisiko eines Investments oder eines Portfolios beziffert. Auf den ersten Blick scheint das ein super praktisches Werkzeug in der Portfoliokonstruktion zu sein, wenn es denn auch funktionieren würde.
Wo liegt die Krux?
Hans Peter Schupp: Bei "Value at Risk" ist es eben genau die vernachlässigte Restwahrscheinlichkeit von in dem Fall 0,5 Prozent. Damit wird die Kennziffer – böse formuliert – zu einem Modell, das nur dann funktioniert, wenn man es gar nicht braucht. Ein Beispiel gefällig? Ein normales Börsenjahr hat um die 200 Handelstage. Und an 199 Tagen erfüllt das Modell auch einwandfrei seine Aufgabe, aber genau der eine Tag, an dem es richtig an der Börse kracht, liegt außerhalb der 99,5-Prozent-Wahrscheinlichkeit. Diese Scheinsicherheit von "Value at Risk" wird sogar noch eklatanter beim Eintritt eines sogenannten Schwarzen Schwans, ein unberücksichtigtes, weil undenkbares Ereignis. Der 11. September 2001 war für Versicherungen ein solcher Schwarzer Schwan, denn bis dahin war es nicht vorstellbar, dass ein Ereignis zu einer Ballung verschiedenster Ansprüche aus Haftpflicht-, Gebäude- oder Lebensversicherungspolicen und gleichzeitig zu einem weltweiten Börsencrash führen könnte. Bis dahin galt Terror als eine Gefahr in abgrenzbaren Regionen und war in vielen Ländern sogar in den allgemeinen Versicherungspolicen als praktisch kostenloser Service mit abgedeckt.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für das Management Ihres eigenen Fonds?
Hans Peter Schupp: Wie Sie in Ihrer Eingangsfrage erwähnt haben, greifen auch wir auf die entsprechenden Kennzahlen und Modelle zurück. Aber ohne uns darauf zu verlassen. Wir halten es lieber wie beim Überqueren einer Straße, indem wir eben nach links und rechts schauen. Deshalb bevorzugen wir es, uns die Unternehmen, in die wir investieren, unter fundamentalen Gesichtspunkten anzuschauen, statt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Zugegeben, auch wenn man die Straße quert, kann man ein Auto übersehen. Beim Investment nennt man das "Value Traps", also Fallen, in die man auch als Fondsmanager laufen kann. Und gegen Schwarze Schwäne sind natürlich auch wir nicht gefeit. Aber wir wähnen uns zumindest nicht in einer statistischen Scheinsicherheit.
Vielen Dank für das Gespräch. (hh)