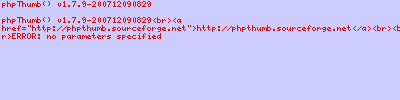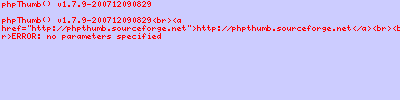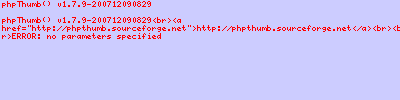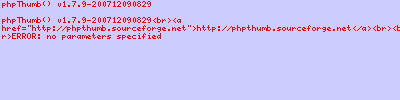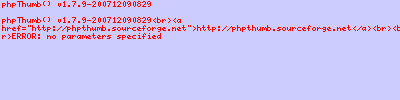Schweizer Nationalbank hält Negativzinsen für unverzichtbar
Die Schweizer Nationalbank lässt weiter keinen Zweifel aufkommen, dass sie den Franken mit vollem Einsatz gegen Aufwertungen verteidigt. SNB-Präsident Thomas Jordan bezeichnete Negativzinsen, die in der Schweiz mittlerweile auch von Kundenberatern geschultert werden müssen als unverzichtbar.
"Für uns sind die Negativzinsen im Moment unverzichtbar, um zumindest teilweise die historische Zinsdifferenz zum Euro und anderen Währungen zu erhalten", sagte Jordan in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ). Ohne die Negativzinsen von aktuell minus 0,75 Prozent könne der Franken noch stärker aufwerten. Die Schweizer Banken hätten die Strafzinsen bisher besser verkraftet als prognostiziert, so Jordan.
Neben den Negativzinsen setzt die SNB auf Devisenmarktinterventionen, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Franken zu vermeiden. Sie druckt Franken und kauft mit dem Geld Anleihen oder Aktien in Fremdwährungen. Dank dieser Politik zählt die SNB zu den großen Investoren an der Wall Street – erntet aber angesichts ihrer mehrere hundert Milliarden Franken großen Bilanz auch Kritik. Jordan verteidigte den Kurs: "Die Vorstellung, dass wir unsere Bilanz einfach nach Lust und Laune ausdehnen und dann quasi die halbe Welt aufkaufen, ist falsch", sagte er.
Strafzinsweitergabe wird ausgeweitet
Indes denken immer mehr Banken laut darüber nach, wie sie mit den für sie belastenden Negativzinsen umgehen. Die UBS Schweiz behält sich etwa vor, Negativzinsen bei sehr vermögenden Privatkunden mit hohen Bargeldbeständen einzuführen. Für einfache Sparer ist das dem Vernehmen nach derzeit kein Thema. Der Ruf danach wird aber bei etlichen Instituten immer wieder laut. Bei zahlreichen schweizer Banken werden Strafgebühren bereits an Groß- und Firmenkunden weitergegeben.
Bankberater müssen entscheiden
Ein Sprecher von Julius Bär sagte kürzlich, dass die Schweizer Privatbank versuche, die Kosten für Negativzinsen auf mehrere Schultern zu verteilen. Einen Teil der Kosten trage die Bank, einen Teil die Kunden und einen Teil sogar die eigenen Kundenberater. Diese könnten entscheiden, inwieweit sie die Gebühr an die Kunden weiterreichen oder aus der eigenen Kasse bezahlen. Wie viel von den Strafzinsen tatsächlich weitergegeben werden, wurde nicht veröffentlicht.
Hintergrund: Das Überraschungsmanöver von 2015
Die Strafzinsen, die die SNB seit Anfang 2015 ab einer gewissen Freigrenze auf bei ihr geparkte Einlagen erhebt, sind Teil einer Maßnahmenserie, die die Märkte damals eiskalt erwischte. Mitte Jänner 2015 hatte die SNB eine Schockwelle ausgelöst, weil sie überraschend den Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken aufgegeben hatte. Gleichzeitig wurde der Zins auf die bei ihr geparkten Gelder um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent angehoben. Die SNB will den Franken wo weit wie möglich unattraktiv für Investoren machen und somit eine weitere Aufwertung verhindern.
Milliardenbelastung für Banken
Die Strafzinsen kosten die Schweizer Banken insgesamt mehr als eine Milliarde Franken pro Jahr. Vor allem reine Privatbanken leiden unter der Gebühr – auch, weil viele vermögende Kunden angesichts der unsicheren Zeiten ihr Geld lieber in bar halten und nicht in Aktien oder Anleihen stecken. Die Banken versuchen daher, ihre Kunden zu motivieren, ihr Geld zu investieren.
Eine Umfrage des Stockholmer Inkassounternehmens Intrum Justitia AB unter 21.000 Personen in 21 Ländern hatte unlängst wieder ergeben, dass die meisten Europäer ihr Geld trotz der Zinssituation noch immer am liebsten auf dem Sparkonto belassen. Etwa 69 Prozent der Europäer bringen ihr Erspartes auf die Bank. (eml)