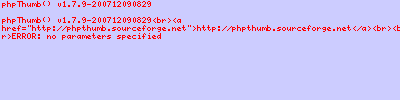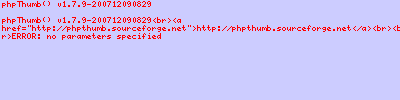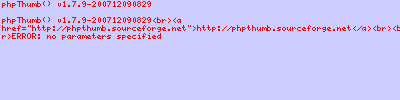Sarasin-Chefökonom: Währungskriege sehen anders aus
Der US-Finanzminister hat jüngst angedeutet, womöglich den Greenback schwächen zu wollen. Vom Beginn eines Währungskriegs kann aber nicht die Rede sein, sagt Karsten Junius, Chefvolkswirt der Bank J. Safra Sarasin.
Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), ist kein Mann harscher Worte. Umso überraschender war jüngst seine scharfe Reaktion auf die Äußerung von US-Finanzminister Steven Mnuchin, dass ein schwacher US-Dollar gut sei für den amerikanischen Außenhandel. Der Wortwechsel sollte allerdings nicht als Beginn eines Währungskrieges missinterpretiert werden, sagt Karsten Junius, Chefvolkswirt der Schweizer Bank J. Safra Sarasin – auch wenn ein solcher prinzipiell zum ökonomischen Nationalismus der Regierung Trump passen würde.
Kriege würden mit Waffen, Strategien und Verbündeten gewonnen, erklärt der Ökonom. "Die US-Administration scheint nichts davon zu besitzen." Als Waffen kämen die Wahl des Wechselkursregimes, Devisenmarktinterventionen und eine sehr expansive Geldpolitik in Frage. Es sei aber kaum vorstellbar, dass die Vereinigten Staaten ihr Wechselkursregime ändern.
Und Devisenmarktinterventionen sowie die Geldpolitik fallen in die Zuständigkeit der Notenbank. Auf diese habe die US-Regierung zwar Einfluss, in dem sie die noch ausstehenden Posten im Zentralbankrat besetzen kann. "Die Unabhängigkeit der Fed sichert aber zudem, dass die FOMC-Mitglieder von der Regierung keine Weisungen befolgen müssen", stellt Junius klar. Würde dies in Frage gestellt, würden die Finanzmärkte wohl ebenfalls die Glaubwürdigkeit des Inflationsziels anzweifeln.
Allein auf weiter Flur
Junius erkennt zudem keine Strategie hinter Mnuchins Aussagen. "Andernfalls wäre er in den Folgetagen kaum zurückgerudert, und auch Präsident Trump hätte sich nicht für einen starken US-Dollar ausgesprochen." Schließlich sei auch nicht zu erkennen, dass die US-Regierung in einem Währungskrieg Verbündete hätte, weder international noch daheim. Die politischen Vorteile einer kompetitiven Greenback-Abwertung wären gering. Junius‘ Fazit: "Schon allein deshalb ist es unwahrscheinlich, dass die US-Regierung es zu einem Währungskrieg kommen lassen würde." (fp)