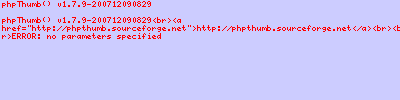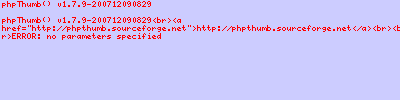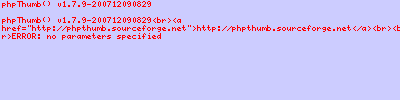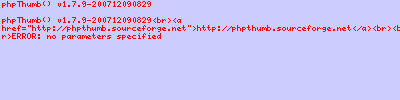HPM: Der Schweizer Franken war nie ein sicheres Spekulationsobjekt
Die jüngste Entscheidung der Schweizer Nationalbank habe Anlegern gezeigt, dass es keine sicheren Spekulationen gibt, sagt Stefan Riße von HPM Hanseatische Portfoliomanagement. Die Bank habe kaum eine andere Wahl gehabt, als den Kurs des Franken freizugeben.
Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat rund zweieinhalb Jahre lang als Untergrenze für den Euro beziehungsweise Obergrenze für den Franken einen Kurs von 1,20 garantiert. Häufig notierte das Währungspaar genau an oder nur knapp über dieser Schwelle, an der dann die SNB intervenierte und alles Angebot aufkaufte, um den Kurs des Euro nicht weiter fallen zu lassen. Wer hier Euro kaufte, hatte also vermeintlich kein Risiko. Denn tiefer als 1,20 konnte es nicht gehen. Doch würde sich die Eurozone erholen, wären Gewinne drin – denn gegen einen Anstieg des Euro hatten die Schweizer nichts. Kaufkraftparitätisch sei der Franken bereits bei 1,20 überbewertet gewesen, sagt Stefan Riße, Gesellschafter der HPM Hanseatische Portfoliomanagement.
In Heerscharen habe es kleine wie große Spekulanten zu den Devisenbrokern getrieben, die es ihren Kunden erlaubten, teilweise mit gigantischen Hebeln von bis zu 400 den Euro gegen den Schweizer Franken zu kaufen. Blind hätten sie darauf vertraut, dass die SNB den Kurs auf jeden Fall verteidigen werde. Den Spekulanten habe ganz offenbar Erfahrung gefehlt, urteilt Riße: Zum einen die Erfahrung, dass es die sichere Spekulation nicht gibt, und zum anderen, dass fixe Devisenkurse auf Dauer noch nie gehalten haben.
SNB stand mit dem Rücken zur Wand
Die erneute Anlegerflucht aus Griechenland, womöglich auch aus Russland, wie auch die Euro-Schwäche gegenüber dem US-Dollar hätten die SNB zuletzt offenbar dazu gezwungen, so gigantische Eurobeträge aufzukaufen, dass sie ihr Limit erreicht sah. "Denn für jeden Euro, den sie kaufte, musste sie einen Schweizer Franken herausreichen, eben an die, die ihre Euros in Franken tauschen wollten", erläutert der Fondsmanager. "Wer im Franken sein möchte, der kann aber auch nur in der Schweiz sein Geld anlegen, und die Volkswirtschaft ist im Vergleich zur Eurozone relativ klein." Schon in den vergangen Jahren hätten sich Land und Immobilien massiv verteuert. Am Ende hätte sich der mietende Schweizer wahrscheinlich keine Wohnung mehr leisten können. "Mit anderen Worten: Die Inflation wäre explodiert, und die Ausländer hätten alles aufgekauft."
Nun dürfte es die Schweizer Exportindustrie schwer haben. Die SNB habe die Wahl zwischen Pest und Cholera gehabt, als sie sich jüngst entschied, den Kurs der von ihr behüteten Währung wieder frei zu geben. "Sie tat es wohl auch, weil die Politik gerade begann darüber zu diskutieren, wie man den hübschen Gewinn der SNB von 38 Milliarden Franken verteilen könne", schätzt Riße. Dieser sei nun weg. Doch es gebe noch mehr Verlierer: Mit Alpari sei der erste Devisenbroker bereits pleite, andere stünden mit dem Rücken zur Wand. Unter den Spekulanten gebe es ebenfalls dramatische Fälle. Bei den Brokern, die die Nachschusspflicht nicht ausgeschlossen haben, dürften sie den Rest ihres Lebens ihre Schulden abzahlen – oder Privatinsolvenz beantragen. (fp)