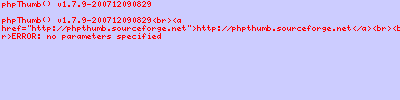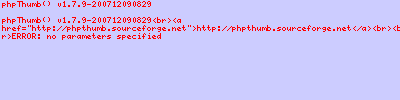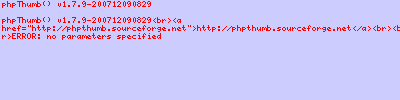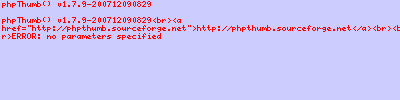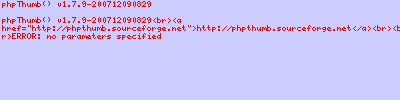Frank Fischers Lehman-Lektion: "In der Krise kommt die Kavallerie!"
Der Kollaps der US-Bank Lehman Brothers jährt sich zum zehnten Mal. Prominente Portfoliomanager verraten FONDS professionell, wie sie die diese Zeit erlebt haben, welche Lehren sie daraus ziehen konnten – und wo sie derzeit die größten Risiken wittern. Heute: Frank Fischer.
In der Nacht vom 14. auf den 15. September 2008 musste Lehman Brothers Insolvenz anmelden. Der Kollaps der US-Investmentbank ließ eine Krise eskalieren, die sich zwar schon abgezeichnet hatte, deren Ausmaß aber die wenigsten erahnt hatten. Zehn Jahre nach diesem einschneidenden Ereignis hat sich FONDS professionell ONLINE bei prominenten Portfoliomanagern umgehört: Wie haben sie die damalige Zeit erlebt? Welchen Fehleinschätzungen sind sie erlegen, und welche Schlüsse zogen sie daraus? Und: Wo lauern heute die größten Risiken für die Finanz- und Wirtschaftswelt?
Die Interviews mit Hendrik Leber, Luca Pesarini, Klaus Kaldemorgen und Henning Gebhardt wurden schon veröffentlicht. Heute steht Frank Fischer von Shareholder Value Management Rede und Antwort, der den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und den Prima – Globale Werte verantwortet. Den Abschluss macht in wenigen Tagen Jens Ehrhardt, der Gründer des Vermögensverwalters DJE Kapital.
Herr Fischer, wie haben Sie das dramatische Wochenende der letztlich gescheiterten Lehman-Rettung im September 2008 erlebt?
Frank Fischer: Das Erstaunliche an der Lehman-Pleite war, dass direkt im Anschluss an die Insolvenz die Marktreaktion noch sehr verhalten ausfiel. Die eigentliche Katastrophe des kompletten Misstrauens der Banken untereinander kristallisierte sich ja erst in den Wochen danach heraus. Keiner wusste, wer diesen Sturm überhaupt überleben würde, als noch nicht klar war, wie Notenbanken und Politik diese Liquiditätsknappheit und die damit verbundenen Risiken auffangen würden.
Hatten Sie erwartet, dass die Krise so tief reicht und derart um sich greift?
Fischer: Aufgrund des sehr hohen Derivate-Volumens und des starken Engagements institutioneller Anleger im US-Subprime-Mortgage-Bereich war klar, dass die Auswirkungen dieser Krise sehr, sehr hart sein würden. Direkt im Anschluss an die Pleite war es aber nicht möglich, den genauen Umfang abzuschätzen. Genau diese Unsicherheit hat sich über Wochen ausgewirkt, weil keiner genau wissen konnte, wie schlimm es wirklich wird. Man konnte wunderbar darauf spekulieren, dass das gesamte Weltfinanzsystem wie ein Kartenhaus zusammenklappt.
Welchen Fehleinschätzungen sind Sie damals unterlegen?
Fischer: Die wichtigste Fehleinschätzung war, dass der vermeintlich sichere Hafen Gold erst einmal nicht funktionierte. Selbst Gold wurde zu Cash gemacht, denn nur Cash und kurz laufende Staatsanleihen bester Bonität wurden als sicher angesehen. Alles andere wurde in Frage gestellt oder eben versilbert, um liquide zu sein. Der Impuls, sofort darauf in die moderate Verwerfung zu kaufen, war auch ein Fehler. Man musste erst einmal die gesamte Brandung dieser Katastrophe abwarten. Die Auswirkungen wirkten über Wochen und Monate in die Stimmung hinein. Erst dann war es möglich, zu Ausverkaufspreisen zuzuschlagen.
Und was haben Sie daraus gelernt?
Fischer: Die Lehre ist, dass in Krisensituationen die Kavallerie kommt. Mit anderen Worten: Die Politik und die Notenbanken springen ein, um zu retten, was nicht rettbar aussieht. Derjenige, der Cash hat – beispielsweise Warren Buffett –, ist in so einer Situation in der Lage, Überrenditen zu erzielen. Er kann als "Lender of Last Resort" auftauchen, zu Sonderkonditionen Titel wie Goldman Sachs oder Swiss Re kaufen und sich dabei eine goldene Nase verdienen. Eine weitere Lehre ist, dass man mit dem Hedging auch Fehler machen kann: In einer solchen Situation ist ein Marktversagen möglich, etwa wenn es aufgrund der Volatilität in den Märkten keinen Handel mit Derivaten gibt.
Im Rückblick: Wo lief das Krisenmanagement der Notenbanken und Politik gut, in welchen Punkten haben die Verantwortlichen versagt?
Fischer: Das Krisenmanagement der Notenbanken selbst lief sehr gut. Gerade die Fed hat im Herbst 2008 schnell die richtigen Schritte ergriffen. Im Nachhinein war es sicher ein Fehler, Lehman über Nacht Pleite gehen zu lassen – im Anschluss gab es Garantien für Goldman und Morgan Stanley. Es dauert aber, bis auf die öffentliche Wahrnehmung einer solch bedeutenden Pleite hinreichende Handlungen folgen, die dem ganzen Ausmaß der Krise gerecht werden. Dies liegt an dem Umstand, dass am Anfang nicht wirklich transparent ist und verlässlich abgeschätzt werden kann, wie stark diese Krise den Einzelnen betrifft. Als sich dies dann zunehmend herauskristallisierte, waren die Reaktionen zum Beispiel von manchen handelnden Personen in Volksbanken oder Sparkassen in Deutschland sehr von Panik getrieben. Das ging so weit, dass die Frauen der Herren Vorstände mit Autos vorgefahren sind – und dann wurde Cash eingeladen oder Goldbarren, um sich für den befürchteten "Reset" des gesamten Finanzsystems zu wappnen. Auch das ist im Nachhinein nicht nachvollziehbar, weil Politiker immer daran arbeiten, die Katastrophe zu vermeiden. Allerdings weiß man in der Situation nicht, wie lange es dauert, bis die Politik reagiert. Solange ist eben Cash erstmal King.
Die Lehman-Pleite löste eine regelrechte Regulierungsflut aus. Sind die Banken Ihrer Meinung nach inzwischen so stabil, dass sie ein ähnliches Szenario unbeschadet überstehen würden?
Fischer: Banken sind vor allem in Europa wahrscheinlich überreguliert. Dies gilt insbesondere für kleinere, nicht systemrelevante Institute, die in großen Teilen dem für Großbanken entwickelten Aufsichtsrecht unterworfen sind. Ferner sind weitere Marktteilnehmer wie Asset Manager und institutionelle Investoren, die gerade keine Banken sind, in einem Ausmaß betroffen, das sich nicht mit ihrer Rolle oder ihrem Beitrag zur Verschärfung der Finanzkrise begründen lässt. Außerdem wurden die Bilanzen der Banken leider nicht konsequent bereinigt, unter anderem in Italien. Eine zügige Zwangs-Rekapitalisierung inklusive Abschreibung fauler Kredite wie in den USA hätte auch Europas Bankensektor gut getan und verhindert, dass viele Probleme selbst zehn Jahre nach der Krise immer noch existieren. Wir haben daraus gelernt, kaufen nach wie vor keine Aktien europäischer Banken, denn die sind wacklig, und die Bilanzen wurden immer noch nicht bereinigt. Regulatorisch richtig war in jedem Fall die Vorgabe, dass Derivate-Geschäfte mit Sicherheiten hinterlegt werden und zunehmend über zentrale Gegenpartien abgewickelt werden müssen.
Um die Banken zu retten, mussten die Staaten in großem Stil private Verbindlichkeiten übernehmen. Das führte letztlich zur Schuldenkrise, die immer noch nicht gelöst ist. Wie kann Ihrer Meinung nach ein Ausweg aus dieser Krise aussehen?
Fischer: Die jetzige Staatsschuldenkrise geht nicht auf die Übernahme der Schulden der Banken oder deren Rekapitalisierung zurück, sondern es ist einfach schon im Vorfeld von den meisten Staaten zu schlecht gehaushaltet und auf Pump gelebt worden. Dass man letzten Endes diese Exzesse der Vorkrisenzeit immer noch fortführt – siehe Italien – ist das aktuelle Problem. Nur wenige Länder, unter anderem Spanien, haben tatsächlich Reformen im nötigen Umfang umgesetzt, die dazu führen, dass es jetzt wieder besser läuft.
Die 2008 ausgebrochene Finanzkrise wird nicht die letzte gewesen sein. Was könnte der Auslöser der nächsten Krise sein?
Fischer: Auslöser der nächsten Krise könnten wiederum die Schuldenberge sein. Diese sind erheblich angewachsen. Ferner gibt es überhaupt keine adäquate Wahrnehmung von Kreditrisiken mehr. Denn Tatsache ist, dass die Zinsen so niedrig sind, dass sie der Bonität der Institutionen überhaupt nicht gerecht werden. Es gibt also für das Kreditrisiko, das man trägt, keine entsprechende Prämie. Sollten die Zinsen steigen, dann wird es diesen Institutionen nicht möglich sein, ausreichende Bonität nachzuweisen, um überhaupt den Schuldendienst leisten zu können. Sie werden dann in Frage gestellt, und die Konsequenz sind erneute Unternehmens- aber auch Staatspleiten. Wenn Schulden weiter zunehmen und dann das Vertrauen zurückgeht, werden Risiken wieder adäquat eingepreist, und es kommt zur nächsten Krise. (bm)