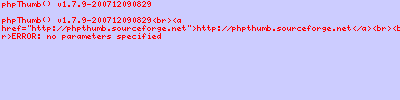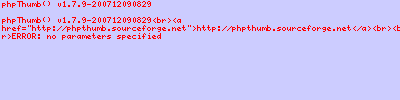"Das Letzte, was die EZB will, ist ein zu starker Euro"
Amundi-Investmentchef Vincent Mortier erklärt im Interview mit FONDS professionell ONLINE, warum die EZB bei Zinssenkungen der Fed folgen wird. Eine Staatsschuldenkrise in Europa drohe derzeit nicht, aber für die Lösung strategischer Probleme zeigt sich Mortier aus einem bestimmten Grund skeptisch.
Herr Mortier, rund um den Jahreswechsel gehen die Expertenmeinungen, wie sich die Notenbanken und die Aktien- oder Anleihenmärkte verhalten werden, stark auseinander. War es für Sie als Ökonom schwieriger, die Prognosen für 2024 zu erstellen als in den Vorjahren?
Vincent Mortier: Um Ihre Frage zu beantworten, muss ich ein Jahr zurückgehen. Ich bin unzufrieden, weil unser Ausblick für 2023 nicht so präzise war, wie ich mir das gewünscht hätte. Für den Ausblick für 2024 habe ich daher 50 unserer Analysten und Portfoliomanager zusammengerufen und über die Ursachen diskutiert. Es hat sich gezeigt, dass wir 2023 vor allem auf der Makro-Ebene überrascht wurden von der Resilienz der US-Wirtschaft. Die geht aber nun zu Ende.
Warum sollte es nicht auch 2024 wieder positive Überraschungen geben?
Mortier: Um zu sehen, warum wir skeptisch sind, muss man die Gründe für die erstaunlich gute Lage im Jahr 2023 analysieren: Erstens haben die USA ein hohes Budgetdefizit von rund acht Prozent des BIP, und sie haben die Wirtschaft stimuliert, etwa durch den Inflation Reduction Act. Das ist sehr ungewöhnlich. Denn ein Land, das Vollbeschäftigung hat und ein anständiges Wachstum, riskiert üblicherweise nicht ein so hohes Defizit. Zweitens: Die negative Auswirkung der höheren Zinsen trifft die Unternehmen mit einer starken Verzögerung. Das deshalb, weil viele Unternehmen auf fixverzinsten Schulden saßen und von den Anhebungen weniger betroffen waren; und sie hatten zum anderen noch viel Cash, das angesichts der steigenden Zinsen ebenfalls höher verzinst wurde. Bei allen US-Unternehmen zusammen sind die Nettozinszahlungen um 30 Prozent gesunken. Das wird sich jedoch nun ändern. Und drittens hatten die US-Konsumenten noch mehr Ersparnisse aus den Covid-Unterstützungen, als wir dachten. Aber jetzt sind diese Reserven aufgebraucht.
"Bei Kreditkartenschulden in den USA liegen die Kreditraten bei um die 20 Prozent."
Was ändert sich nun 2024?
Mortier: In den USA erwarten wir ein sehr geringes Wachstum beziehungsweise eine leichte Rezession. In den Bilanzen der US-Firmen sind die Cash-Positionen aufgrund von Rückzahlungen und Übernahmen stark abgeschmolzen. Dazu kommt, dass sich in nächster Zeit eine hohe Anzahl eher schlecht aufgestellter Unternehmen refinanzieren muss. Firmen mit guten Bonitäten konnten sich während der Covid-Pandemie häufig Geld für zehn Jahre ausborgen, hatte man hingegen eine eher schlechte Bonität, bekam man Geld eher nur für drei bis fünf Jahre. Diese Firmen mit schlechter Bonität müssen nun an den Kapitalmarkt. Die Risikokosten werden also steigen.
Sie haben auch die Erschöpfung der US-Konsumenten angesprochen...
Mortier: In den vergangenen Monaten gab es eine sehr große Nachfrage nach Konsumkrediten. Man muss wissen, bei Kreditkartenschulden in den USA liegen die Kreditraten bei um die 20 Prozent, während es im Immobilienbereich acht Prozent sind. Bereits jetzt sehen wir steigende Ausfallraten bei Konsumkrediten. Das ist ungewöhnlich in Zeiten hoher Beschäftigung. Und auch die US-Regierung ist beim Geldausgeben zusehends beschränkt, weil die Investoren die hohen Schuldenlevel hinterfragen.
Woran sieht man, dass die Toleranz der Investoren sinkt?
Mortier: Im Herbst des Vorjahres gab es einen Panikmoment, weil die Zinsen für die zehnjährigen US-Anleihen kurz die Fünf-Prozent-Marke überschritten haben. Als Reaktion darauf hat das US-Schatzamt für einige Wochen keine zehnjährigen Anleihen mehr ausgegeben. Es zeigt sich, dass nicht mehr alles vom Markt akzeptiert wird. Es gibt einen Druck auf die USA, das Defizit zu kontrollieren. Dabei gäbe es viel zu finanzieren, wie auch in Europa. Etwa die Energiewende oder die strategische Autonomie.
Amundi erwartet wie viele Beobachter 2024 Zinssenkungen. Die Rezession in den USA oder in Europa soll nach gängiger Meinung sehr mild werden. Rechtfertigt es eine leichte Konjunkturflaute, dass Notenbanken von Zinsanhebungen auf -senkungen umschalten?
Mortier: Ja, ich denke schon. Die Fed hat ja zwei Mandate, den Jobmarkt und die Inflation. Die Inflation wird sich entlang des Zwei-Prozent-Ziels stabilisieren. Gleichzeitig macht die Abschwächung der Wirtschaft Sorgen. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Zinsen Mitte des Jahres sinken werden.
Wie mild oder aggressiv wird die Fed vorgehen?
Mortier: Wir erwarten einen Einschnitt um 150 Basispunkte, das ist signifikant und wird sich im Jahr 2025 fortsetzen. Wir denken, dass sich die langfristigen Anleihenzinsen aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch reduzieren. Unser Ziel für die zehnjährigen US-Anleihen ist 3,7 Prozent. Heute sind wir bei knapp vier Prozent.
Wie geht es in der Eurozone weiter?
Mortier: Für Europa haben wir mehr oder weniger dieselben Prognosen wie für die USA. Mit einem Wachstum nahe Null. In Europa ist es sehr vom Land abhängig. Hier sehen wir oft harte Diskussionen über die fiskalen Regeln. In Deutschland hat zum Beispiel das Verfassungsgericht unlängst die Verwendung nicht benötigter Corona-Gelder für den Klimaschutz verboten. Wegen der hohen Staatsschulden haben die Staaten immer weniger Raum für weitere Konjunktur-Stimuli. Gleichzeitig haben wir in Europa geringe Wachstumsaussichten. Wir sehen momentan nichts, was die Situation zum Positiven verändern könnte. Europa hat noch immer eine hohe strategische Abhängigkeit bei der Energie und ist bei Chips oder Batterien für E-Autos von China oder den USA abhängig.
"Italien ist beim hohen Anteil der Inlandsverschuldung ein bisschen wie Japan geworden."
Werden wir bald wieder über Staatsschuldenkrisen reden müssen?
Mortier: Man sollte nie "nie" sagen. So was kann passieren, wenn aus irgendeinem Grund eine Vertrauenskrise eintritt. Aber heute sehen wir den Katalysator dafür nicht.
Italiens Schulden liegen bei 145 Prozent des BIP...
Mortier: Italien steht bei genauerem Hinsehen nicht so schlecht da. Zum Beispiel werden mehr als zwei Drittel der Staatsschulden von lokalen Investoren gehalten. Diese inländischen Investoren sind bei Marktvolatilitäten weniger sensibel. Italien ist beim hohen Anteil der Inlandsverschuldung ein bisschen wie Japan geworden. Ein großer Unterschied zur Staatsschuldenkrise im Jahr 2011 ist, dass heute wirklich jedes Land in Europa Herausforderungen hat und man nicht sagen kann, "es gibt einen guten Norden und einen hochverschuldeten Süden". Eine wirkliche Krise sehen wir aber auch deshalb nicht, weil wir heute etwa Auffangnetze haben wie den "Anti-Fragmentierungs-Mechanismus", mit dem die EZB gegen Zinsdifferenzen zwischen einzelnen Ländern vorgehen kann. Wir denken also nicht, dass eine Staatsschuldenkrise ein großes Risiko ist, aber das heißt nicht, dass es gar kein Risiko gibt.
Die Schwierigkeiten treten vielleicht eher schleichend auf; wenn die Refinanzierung zu höheren Zinsen immer schwieriger wird. Ist es kein Problem, dass Staaten für den Zinsdienst einen immer höheren Teil des Budgets aufwenden müssen?
Mortier: Es ist bereits ein Problem in den USA, wo die Laufzeiten während der Covid-Pandemie überhaupt nicht gemanagt wurden. Italien hingegen hat zum Beispiel zu Covid-Zeiten die Chancen der niedrigen Zinsen genutzt. Sie haben die durchschnittlichen Laufzeiten ihrer Schulden mit günstigen Zinsen um drei Jahre verlängert. In den USA nehmen allein die Zinszahlungen 3,6 Prozent vom BIP in Anspruch, und der Wert soll auf sechs Prozent im Jahr 2029 steigen. Das ist massiv. Es ist Geld, das man nicht für andere Zwecke ausgeben kann. In Europa wird das für hochverschuldete Länder wie Italien nicht dieses oder nächstes Jahr ein Problem, sondern eher in Zukunft. Momentan sind die Zinslevel in Europa aber tief. In Italien sogar tiefer als in den USA, was überraschen mag.
Wie, denken Sie, geht die EZB bei den Zinsen vor?
Mortier: Wir denken, dass die EZB ebenfalls die Zinsen senken wird. Aber in einem geringeren Ausmaß, nämlich um 50 bis 75 Basispunkte, nicht um 150 Basispunkte wie in den USA.
"Was die EZB niemals zugeben würde, ist, dass sie auch ein Auge auf die Wechselkurse hat."
EZB-Mitglieder warnen immer wieder davor, definitiv eine Zinssenkung zu erwarten.
Mortier: Was die EZB niemals zugeben würde, ist, dass sie auch ein Auge auf die Wechselkurse hat. Wenn die US-Zinsen stark sinken, in der Eurozone aber nicht, dann wird der Euro aufwerten. Ein zu starker Euro ist schlecht für die Exporteure und wird das Wachstum in der Eurozone bremsen. Wir wissen, dass die Verantwortlichen in der EZB darauf schauen. Und das Letzte, was sie wollen, ist ein zu starker Euro.
Sie haben vorhin die strategischen Abhängigkeiten erwähnt, die das Wachstum in Europa hemmen. Wir bräuchten mehr Strukturreformen. Sehen Sie irgendwas am Horizont, das Europa langfristig Hoffnung gibt?
Mortier: Wir haben das "Next Generation EU"-Programm, das die Energiewende und damit zusammenhängende strategische Themen finanzieren soll. Aber leider wurden bis jetzt nur 30 Prozent der möglichen Mittel abgerufen. Das zeigt uns, dass es Probleme gibt bei den Strukturreformen. Europa kann nur einen Rebound hinlegen, wenn es ein gewisses Maß an gemeinsamen Visionen und strategischen Initiativen gibt. Ich möchte nicht zu pessimistisch sein, aber im Juni finden die europäischen Parlamentswahlen statt. Europa ist mehr und mehr inhomogen, es kommen immer mehr Populisten an die Macht. Das sind Politiker, die nicht auf mehr europäische Integration drängen oder auf geteilte Schulden.
Investoren, die in nächster Zeit Wachstum haben wollen, können also nicht auf die USA oder Europa hoffen. Dafür sind die Prognosen für die Emerging Markets momentan recht zuversichtlich…
Mortier: Ja, da gibt es wirklich eine historisch große Wachstumslücke zwischen den Industrienationen und den Emerging Markets. Japan wird als Industrieland zwar eine positive Ausnahme darstellen, weil wir hier 1,5 Prozent Wachstum erwarten. Das ist viel besser als alles, was wir zuletzt in Japan gesehen haben. Aber wo es wirklich gute Aussichten gibt, ist Asien im Gesamten.
Welche asiatischen Volkswirtschaften entwickeln sich am stärksten?
Mortier: China dürfte um knapp unter vier Prozent zulegen. Das Wachstum dort wird auch qualitativ besser, weil das Land gerade den Immobilienschock bereinigt. Der Konsens ist sehr pessimistisch für China, wir sind da viel optimistischer. In Südasien erwarten wir fünf bis sechs Prozent Wachstum, getragen von Ländern wie Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand, die auch von der Nähe zu China profitieren. Indien ist mit fünf bis sechs Prozent Wachstum ebenfalls sehr stark. Hier gibt es viele strategische Projekte zu Energiewende und Infrastruktur. Wir unterschätzen generell die Energiewende-Anstrengungen in Asien. Allein in China werden dieses Jahr genauso viele Erneuerbare-Energie-Kapazitäten in Betrieb genommen wie in Europa.
Vielen Dank für das Gespräch. (eml)